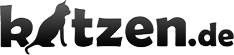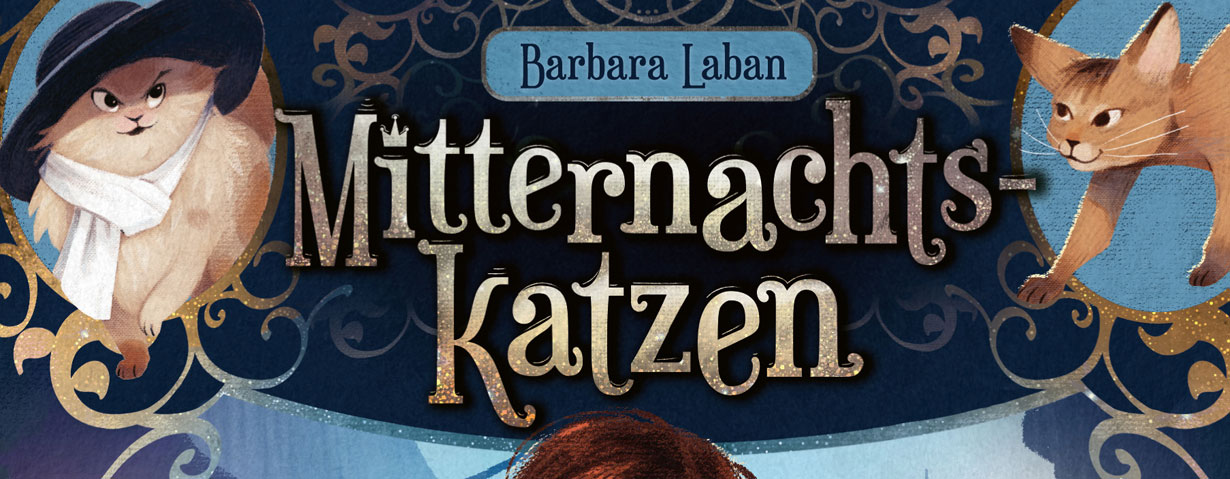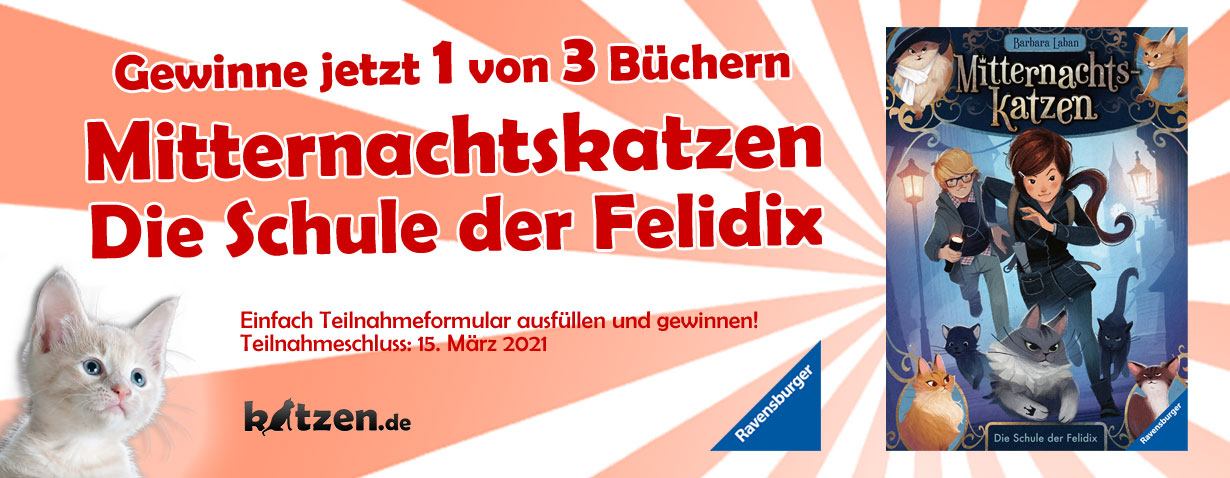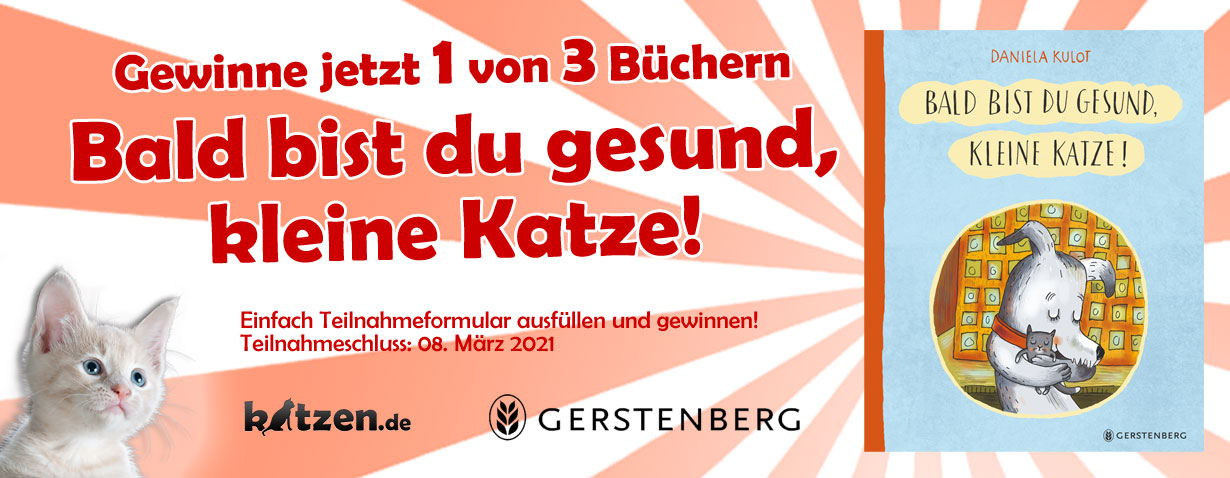Jede äußerliche Veränderung und auch jede Veränderung im Verhalten kann Anzeichen einer
Krankheit sein. Diese Anzeichen können sein: Kahle Stellen im Fell bzw. eklatant
viel Haarausfall, Schuppenbildung, Durchfall, Niesen, Husten, Würgen etc. Dies sind sehr
auffällige Anzeichen. Es gibt auch weniger auffällige Anzeichen wie z.B. Appetitlosigkeit,
starker Durst, Lustlosigkeit, häufiges Aufsuchen der Katzentoilette etc. Alle Anzeichen, die
uns als aufmerksamen Katzenbesitzer alarmieren, sollten ernst genommen werden. Es muss
nicht immer eine ernste Krankheit dahinter stecken, aber Vorsorge ist besser als dem Tier
eine verschleppte Krankheit zuzumuten. Appetitlosigkeit und Lustlosigkeit (Teilnahmslosigkeit)
könnten z.B. ein Anzeichen von Fieber sein. Es ist ratsam als Katzenbesitzer ein (digitales)
Fieberthermometer für Katzen zu besitzen. Im Normalfall beträgt die Temperatur bei einer Katze 38,3° C bis 38,8° C.
Wir bitten Sie, die Texte über Krankheiten nicht dem Besuch beim Tierarzt vorzuziehen. Sie sind nicht dazu geeignet, selber Diagnosen zu erstellen. Wir haben die Texte aus verschiedenen Büchern recherchiert, geben aber keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit dieser Texte.
Katzenschnupfen
Katzenseuche
Leukose
Katzen-"AIDS"
Infektiöse Bauchfellentzündung (FIP)
Tollwut
Katzenpocken
Wir bitten Sie, die Texte über Krankheiten nicht dem Besuch beim Tierarzt vorzuziehen. Sie sind nicht dazu geeignet, selber Diagnosen zu erstellen. Wir haben die Texte aus verschiedenen Büchern recherchiert, geben aber keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit dieser Texte.
Katzenschnupfen
Katzenseuche
Leukose
Katzen-"AIDS"
Infektiöse Bauchfellentzündung (FIP)
Tollwut
Katzenpocken
Katzenschnupfen
Beim sogenannten "Katzenschnupfen" handelt es sich um eine Entzündung der Schleimhäute des Kopfes (Nase, Mund, Augen), die sich entlang der Atemwege bis zur Lunge hin ausdehnen kann. Hervorgerufen wird er in erster Linie durch verschiedene Viren, vor allem Herpes- und Calici-Viren, aber auch einige Bakterienarten können daran beteiligt sein. Die Erreger werden durch Niesen, Husten und mit dem Speichel weiterverbreitet und so von Katze zu Katze übertragen. Deshalb besteht in größeren Katzenbeständen (Tierheimen, Katzenpensionen) eine besonders hohe Ansteckungsgefahr. Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung beträgt 2 bis 5 Tage. Erste charakteristische Anzeichen sind häufiges Niesen und vermehrter Nasen- und Augenausfluss, der mit Fieber und Appetitlosigkeit einhergehen kann. Die Krankheit kann in ihrem Verlauf stark variieren. Während in leichten Fällen die genannten Symptome in wenigen Tagen verschwinden, dauern sie in schwereren Fällen mehrere Wochen an. Auge und Nase sind dann durch eitrigen Ausfluss stark verklebt, die Atembehinderung wird durch Schniefen und Röcheln vernehmlich. Die Entzündung der Lidbindehäute kann auf die Hornhäute übergreifen, und zwar so stark, dass sich dort richtige Geschwüre entwickeln. Schmerzhafte Entzündungen der Mundschleimhaut sowie das Unvermögen, das Futter zu riechen, veranlassen die Katzen dazu, die Futteraufnahme einzustellen. Wenn die Lunge von der Entzündung miterfasst ist, tritt auch Husten auf. Die Schwere des Verlaufs hängt vom Alter und Allgemeinzustand des Patienten ab: Ältere Katzen überstehen den Schnupfen meist schneller als Jungtiere oder Katzen mit z.B. durch Wurm- oder Flohbefall geschwächtem Abwehrsystem, bei denen er sogar zum Tode führen kann.
Als Folgeschäden des Schnupfen können Hornhautnarben, die das Sehvermögen beeinträchtigen, sowie Veränderungen an den Nasenmuscheln und Nasennebenhöhlen zurückbleiben. Letztere bilden auch die Grundlage des chronischen Katzenschnupfens, der einer therapierestistenten Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) die Katze lebenslang belasten kann. Grundziel der Behandlung ist es, durch optimale Umweltbedingungen die eigene Abwehr der Katze soweit zu stärken, dass sie in der Lage ist, die Erreger selbst zu bekämpfen. So spielen hier, neben der Verabreichung von Antibiotika zur Vermeidung bakterieller Sekundärinfektionen, pflegende Maßnahmen des Besitzers eine wichtige Rolle. Augen und Nase sollten mehrfach täglich mit Kamillelösung gereinigt werden, bevor antibiotische und/oder schleimhautabschwellende Tropfen dort eingebracht werden. Nahrung und Flüssigkeit sollten häufig angeboten bzw. sogar eingeflößt werden, sofern die Futteraufnahme verweigert wird. Dafür eignen sich energiereiche Pasten, z.B. Nutrical (Albrecht) oder ad-Diät (Hills), die durch ihre halbflüssige Form auch sehr gut mit Einmalspritzen ins Maul eingegeben werden können und schon in geringen Mengen zur Deckung des Kalorienbedarfs ausreichen. Vom Tierarzt können zudem neben Immunseren (Serocat) auch sogenannte "Immuninducer" (z.B. Baypamun) eingesetzt werden, d.h. Mittel, die die körperliche Abwehr der Katze anregen. Als Prophylaxe gegen den Katzenschnupfen empfiehlt sich für Katzen mit Freigang oder mit Kontakt zu freilaufenden Artgenossen die entsprechende Schutzimpfung im jährlichen Abstand, wobei Impfung mittels Injektion oder auch in Form von Augen- oder Nasentropfen verabreicht werden kann.
Einschränkend muss hier erwähnt werden, dass die Impfung vor allem einen guten Schutz gegen schwere Verlaufsformen des Schnupfens bietet. Trotzdem können auch bei geimpften Katzen Schnupfenerkrankungen vorkommen. Mehrere Faktoren sind hierfür verantwortlich: - Von der Vielzahl der möglichen Schnupfenerreger sind nur die wichtigsten - und je nach Impfstoff unterschiedliche - enthalten. Die Grippeimpfung des Menschen verhindert ja auch nicht jede Erkältung, sondern nur die gefährlichsten Formen. - Außerdem besitzen Schnupfenviren in hohem Maße die Fähigkeit zur genetischen Veränderung (Mutation), mit der es ihnen immer wieder gelingt, dem Immunsystem eines geimpften Tieres zu entkommen, da es für die neue Variante des Virus noch keine passenden Antikörper besitzt. - Weiterhin wird der Katzenschnupfen, wie eingangs erwähnt, u.a. durch Herpesviren ausgelöst. Herpesviren haben die Fähigkeit, in einem Organismus anwesend zu sein, ohne Krankheitserscheinungen hervorzurufen. Beim Menschen sind Herpesviren für die unangenehmen Bläschen an Lippen oder im Mund verantwortlich, die immer zu Zeiten vermehrten physischen oder psychischen Stresses - z.B. bei einer Grippe, bei UV-Bestrahlung im Skiurlaub oder bei Prüfungsstress - wieder auftauchen. Genauso können Herpesviren bei einmal infizierten Katzen bei Stress (Pensionsaufenthalt, Tierarztbesuch, Besitzerwechsel, Ausstellung etc.), wenn auch in milderer Form, trotz Impfung wieder in Erscheinung treten.
Beim sogenannten "Katzenschnupfen" handelt es sich um eine Entzündung der Schleimhäute des Kopfes (Nase, Mund, Augen), die sich entlang der Atemwege bis zur Lunge hin ausdehnen kann. Hervorgerufen wird er in erster Linie durch verschiedene Viren, vor allem Herpes- und Calici-Viren, aber auch einige Bakterienarten können daran beteiligt sein. Die Erreger werden durch Niesen, Husten und mit dem Speichel weiterverbreitet und so von Katze zu Katze übertragen. Deshalb besteht in größeren Katzenbeständen (Tierheimen, Katzenpensionen) eine besonders hohe Ansteckungsgefahr. Die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch der Erkrankung beträgt 2 bis 5 Tage. Erste charakteristische Anzeichen sind häufiges Niesen und vermehrter Nasen- und Augenausfluss, der mit Fieber und Appetitlosigkeit einhergehen kann. Die Krankheit kann in ihrem Verlauf stark variieren. Während in leichten Fällen die genannten Symptome in wenigen Tagen verschwinden, dauern sie in schwereren Fällen mehrere Wochen an. Auge und Nase sind dann durch eitrigen Ausfluss stark verklebt, die Atembehinderung wird durch Schniefen und Röcheln vernehmlich. Die Entzündung der Lidbindehäute kann auf die Hornhäute übergreifen, und zwar so stark, dass sich dort richtige Geschwüre entwickeln. Schmerzhafte Entzündungen der Mundschleimhaut sowie das Unvermögen, das Futter zu riechen, veranlassen die Katzen dazu, die Futteraufnahme einzustellen. Wenn die Lunge von der Entzündung miterfasst ist, tritt auch Husten auf. Die Schwere des Verlaufs hängt vom Alter und Allgemeinzustand des Patienten ab: Ältere Katzen überstehen den Schnupfen meist schneller als Jungtiere oder Katzen mit z.B. durch Wurm- oder Flohbefall geschwächtem Abwehrsystem, bei denen er sogar zum Tode führen kann.
Als Folgeschäden des Schnupfen können Hornhautnarben, die das Sehvermögen beeinträchtigen, sowie Veränderungen an den Nasenmuscheln und Nasennebenhöhlen zurückbleiben. Letztere bilden auch die Grundlage des chronischen Katzenschnupfens, der einer therapierestistenten Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) die Katze lebenslang belasten kann. Grundziel der Behandlung ist es, durch optimale Umweltbedingungen die eigene Abwehr der Katze soweit zu stärken, dass sie in der Lage ist, die Erreger selbst zu bekämpfen. So spielen hier, neben der Verabreichung von Antibiotika zur Vermeidung bakterieller Sekundärinfektionen, pflegende Maßnahmen des Besitzers eine wichtige Rolle. Augen und Nase sollten mehrfach täglich mit Kamillelösung gereinigt werden, bevor antibiotische und/oder schleimhautabschwellende Tropfen dort eingebracht werden. Nahrung und Flüssigkeit sollten häufig angeboten bzw. sogar eingeflößt werden, sofern die Futteraufnahme verweigert wird. Dafür eignen sich energiereiche Pasten, z.B. Nutrical (Albrecht) oder ad-Diät (Hills), die durch ihre halbflüssige Form auch sehr gut mit Einmalspritzen ins Maul eingegeben werden können und schon in geringen Mengen zur Deckung des Kalorienbedarfs ausreichen. Vom Tierarzt können zudem neben Immunseren (Serocat) auch sogenannte "Immuninducer" (z.B. Baypamun) eingesetzt werden, d.h. Mittel, die die körperliche Abwehr der Katze anregen. Als Prophylaxe gegen den Katzenschnupfen empfiehlt sich für Katzen mit Freigang oder mit Kontakt zu freilaufenden Artgenossen die entsprechende Schutzimpfung im jährlichen Abstand, wobei Impfung mittels Injektion oder auch in Form von Augen- oder Nasentropfen verabreicht werden kann.
Einschränkend muss hier erwähnt werden, dass die Impfung vor allem einen guten Schutz gegen schwere Verlaufsformen des Schnupfens bietet. Trotzdem können auch bei geimpften Katzen Schnupfenerkrankungen vorkommen. Mehrere Faktoren sind hierfür verantwortlich: - Von der Vielzahl der möglichen Schnupfenerreger sind nur die wichtigsten - und je nach Impfstoff unterschiedliche - enthalten. Die Grippeimpfung des Menschen verhindert ja auch nicht jede Erkältung, sondern nur die gefährlichsten Formen. - Außerdem besitzen Schnupfenviren in hohem Maße die Fähigkeit zur genetischen Veränderung (Mutation), mit der es ihnen immer wieder gelingt, dem Immunsystem eines geimpften Tieres zu entkommen, da es für die neue Variante des Virus noch keine passenden Antikörper besitzt. - Weiterhin wird der Katzenschnupfen, wie eingangs erwähnt, u.a. durch Herpesviren ausgelöst. Herpesviren haben die Fähigkeit, in einem Organismus anwesend zu sein, ohne Krankheitserscheinungen hervorzurufen. Beim Menschen sind Herpesviren für die unangenehmen Bläschen an Lippen oder im Mund verantwortlich, die immer zu Zeiten vermehrten physischen oder psychischen Stresses - z.B. bei einer Grippe, bei UV-Bestrahlung im Skiurlaub oder bei Prüfungsstress - wieder auftauchen. Genauso können Herpesviren bei einmal infizierten Katzen bei Stress (Pensionsaufenthalt, Tierarztbesuch, Besitzerwechsel, Ausstellung etc.), wenn auch in milderer Form, trotz Impfung wieder in Erscheinung treten.
Katzenseuche
Die Katzenseuche oder auch Panleukopenie ist eine höchst ansteckende Virusinfektion, die sich durch heftiges Erbrechen und Durchfall, begleitet von hohem Fieber, bemerkbar macht. Ausgelöst wird sie durch ein sehr kleines Virus, ein Parvovirus, das wiederum mit dem Erreger der Parvovirose oder "Katzenseuche" des Hundes verwandt ist. Eine Übertragung vom Hund auf Katze oder umgekehrt ist jedoch nicht möglich. Da Parvovoviren sich durch eine hohe Widerstandskraft gegenüber Umwelteinflüssen wie Kälte oder sogar Fäulnis auszeichnen und sich in einer verseuchten Umgebung, besonders in geschlossenen Räumen, monatelang halten können, besteht neben der direkten Ansteckungsgefahr auch eine indirekte über Gegenstände, die mit infizierten Katzen in Kontakt waren. Daher empfiehlt sich selbst für nur in der Wohnung gehaltenen Katzen die Impfung gegen diese Erkrankung. Nach einer Inkubationszeit von 4 bis 6 Tagen treten als erste Symptome Mattigkeit, Futterverweigerung, Erbrechen und hohes Fieber (40°C bis 41°C) auf. Die Katzenseuche kann besonders bei Jungtieren binnen 12 bis 36 Stunden zum Tod führen. Zum anfänglichen Erbrechen kommt Durchfall hinzu. Beides zusammen verursacht starken Flüssigkeitsverlust und Austrocknung.
Charakteristisch ist außerdem eine Verminderung der weißen Blutzellen, die vom Tierarzt nach einer Blutentnahme ermitteln und sowohl zum Nachweis dieser Infektion als auch zur Beurteilung der Heilungschance herangezogen werden kann. Eine Genesung ist durchaus möglich, aber, wie auch beim Schnupfen, abhängig vom Alter und Allgemeinzustand der Katze. So haben ältere, gut ernährte Tiere eine deutlich bessere Chance, bei intensiver Behandlung die Erkrankung zu überstehen, als Jungtiere oder abgemagerte und geschwächte Tiere. Die intensive Behandlung zielt in erste Linie darauf ab, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Das erfolgt anfänglich durch intravenöse Infusion von Elektrolytlösungen durch den Tierarzt und kann später, wenn das Erbrechen aufgehört hat, durch Einflößen solcher Lösungen vom Katzenhalter selbst fortgeführt werden. Parallel dazu erhält die Katze Antibiotika, um zusätzliche bakterielle Infektionen zu verhindern. Auch stehen Hochimmunseren (Feliserin, Serocat) zur Verfügung, deren Anwendung im Anfangsstadium hilfreich sein kann. Die beste Möglichkeit, die Katze vor dieser Erkrankung zu bewahren, besteht jedoch in der vorbeugenden Schutzimpfung, die jährlich aufgefrischt wird und wegen des Übertragungsweges des Erregers für alle Katzen sinnvoll ist. Gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen kann gleichzeitig im Kombinationsimpfstoffen geimpft werden.
Die Katzenseuche oder auch Panleukopenie ist eine höchst ansteckende Virusinfektion, die sich durch heftiges Erbrechen und Durchfall, begleitet von hohem Fieber, bemerkbar macht. Ausgelöst wird sie durch ein sehr kleines Virus, ein Parvovirus, das wiederum mit dem Erreger der Parvovirose oder "Katzenseuche" des Hundes verwandt ist. Eine Übertragung vom Hund auf Katze oder umgekehrt ist jedoch nicht möglich. Da Parvovoviren sich durch eine hohe Widerstandskraft gegenüber Umwelteinflüssen wie Kälte oder sogar Fäulnis auszeichnen und sich in einer verseuchten Umgebung, besonders in geschlossenen Räumen, monatelang halten können, besteht neben der direkten Ansteckungsgefahr auch eine indirekte über Gegenstände, die mit infizierten Katzen in Kontakt waren. Daher empfiehlt sich selbst für nur in der Wohnung gehaltenen Katzen die Impfung gegen diese Erkrankung. Nach einer Inkubationszeit von 4 bis 6 Tagen treten als erste Symptome Mattigkeit, Futterverweigerung, Erbrechen und hohes Fieber (40°C bis 41°C) auf. Die Katzenseuche kann besonders bei Jungtieren binnen 12 bis 36 Stunden zum Tod führen. Zum anfänglichen Erbrechen kommt Durchfall hinzu. Beides zusammen verursacht starken Flüssigkeitsverlust und Austrocknung.
Charakteristisch ist außerdem eine Verminderung der weißen Blutzellen, die vom Tierarzt nach einer Blutentnahme ermitteln und sowohl zum Nachweis dieser Infektion als auch zur Beurteilung der Heilungschance herangezogen werden kann. Eine Genesung ist durchaus möglich, aber, wie auch beim Schnupfen, abhängig vom Alter und Allgemeinzustand der Katze. So haben ältere, gut ernährte Tiere eine deutlich bessere Chance, bei intensiver Behandlung die Erkrankung zu überstehen, als Jungtiere oder abgemagerte und geschwächte Tiere. Die intensive Behandlung zielt in erste Linie darauf ab, den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Das erfolgt anfänglich durch intravenöse Infusion von Elektrolytlösungen durch den Tierarzt und kann später, wenn das Erbrechen aufgehört hat, durch Einflößen solcher Lösungen vom Katzenhalter selbst fortgeführt werden. Parallel dazu erhält die Katze Antibiotika, um zusätzliche bakterielle Infektionen zu verhindern. Auch stehen Hochimmunseren (Feliserin, Serocat) zur Verfügung, deren Anwendung im Anfangsstadium hilfreich sein kann. Die beste Möglichkeit, die Katze vor dieser Erkrankung zu bewahren, besteht jedoch in der vorbeugenden Schutzimpfung, die jährlich aufgefrischt wird und wegen des Übertragungsweges des Erregers für alle Katzen sinnvoll ist. Gegen Katzenseuche und Katzenschnupfen kann gleichzeitig im Kombinationsimpfstoffen geimpft werden.
Leukose
Die Leukose gehörte lange Zeit mit zu den von Katzenbesitzern gefürchtetsten Erkrankungen, da sie unweigerlich tödlich verläuft und früher kein Impfstoff gegen Sie zur Verfügung stand. Seit einigen Jahren sind aber sogar mehrere Impfstoffe auf dem Markt. Unter nicht geimpften Katzen stellt Leukose jedoch immer noch die häufigste infektiöse Todesursache dar. Der Erreger ist wiederum ein Virus (FeLV = Felines Leukose-Virus), das zwar zur selben Gruppe von Viren zählt wie das humane Immunschwäche-Virus (HIV), der AIDS-Erreger, aber nicht auf Menschen übertragbar ist. Dieser Verwandtschaft entsprechend ähnelt die Leukose bei der Katze in ihrer Symptomatik teilweise dem erworbenen Immundefizienssyndrom (AIDS = Aquired Immunde Deliciency Syndrome) des Menschen. Das sogenannte "Katzen-AIDS" (siehe nächste Ausführung) wird allerdings durch ein anderes Virus (FIV = Felines Immundefizienz-Virus) hervorgerufen, das ebenfalls mit dem humanen HIV verwandt ist. Die Ansteckung erfolgt über direkten engen Kontakt beim friedlichen Zusammenleben, durch gegenseitiges Lecken; Putzen, gemeinsames Benutzen der Katzentoilette, sowie bei kämpferischen Auseinandersetzungen durch Bisse. Sie wird meist vom Besitzer nicht wahrgenommen, da sie zunächst nur zu einer leichten Erhöhung der Körpertemperatur führt. Die Mehrzahl der infizierten Katzen bildet in der Folge genügend Abwehrstoffe gegen das Virus und eliminiert es aus dem Körper. Lediglich 2 bis 6 % der einmal infizierten Katzen gelingt dies jedoch nicht. Sie bleiben Virusträger, scheiden es mit sämtlichen Körperflüssigkeiten aus und infizieren damit andere Katzen. Erste typische Symptome der Krankheit treten allerdings erst 1 bis 2 Jahre nach der Ansteckung auf. Die Symptome sind sehr vielfältig und beruhen auf der Vorliebe des Leukosevirus, Blutzellen und ihre Vorstufen zu befallen. Sind bereits die Vorstufen, die im Knochenmark gebildet werden, betroffen, werden nicht mehr genügend rote Blutkörperchen ins Blut nachgeliefert.
Der Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) macht sich in allgemeiner Schwäche und Müdigkeit bemerkbar. Die Schleimhäute im Mund und am Auge erscheinen dann blass, fast weiß. Werden dagegen die weißen Blutzellen geschädigt und zerstört, können sie ihre Aufgabe, andere Infektionen abzuwehren, nicht mehr erfüllen. Es entsteht das Bild der Immunschwäche, d.h. die Katze erkrankt häufiger und schwerer an anderen Infektionen, z.B. an Schnupfen. Sie leidet ständig an Durchfall, Ohren- und Zahnfleischentzündungen, oft starken Floh- und Wurmbefall, Abszessen und anderen Hauterkrankungen. Anstatt die weißen Blutzellen zu schädigen, vermag das Virus auch, sie zu vermehrtem Wachstum anzuregen, mit der Folge, dass Tumore in inneren Organen (Leber, Nieren, Milz), aber auch in der Haut oder in den Lymphknoten entstehen. Tumore bei jungen Katzen sind immer leukosebedingt. Den Nachweis einer Leukose liefert im Verdachtsfall ein Leukosetest, ein relativ einfach und schnell durchzuführender Bluttest, mit dem das Virus im Blut entdeckt werden kann. Während bei einer kranken Katze ein positives Testergebnis eine Leukose beweist, zeigt es bei einer klinisch gesunden Katze nur an, dass sie sich gerade mit dem Virus auseinandersetzt. In diesem Fall muss der Test nach 3 Monaten wiederholt werden, um zu sehen, ob ihr Immunsystem das Virus erfolgreich abgewehrt hat oder ob die Katze als permanent infiziert anzusehen ist. Natürlich sollte die Katze auf Grund der Ansteckungsgefahr in der Zwischenzeit von anderen Katzen getrennt gehalten werden. Im Falle eines positiven Leukosetests ergibt sich die Frage nach einer möglichen und sinnvollen Behandlung. Prinzipiell ist Leukose nicht heilbar, aber leukosepositive Tiere, die noch keine Krankheitserscheinungen zeigen, können trotz Infektion durchaus noch einige Jahre weiterleben. Selbstverständlich sollte ihnen keinesfalls Freigang gewährt werden, da sie ja das Virus weitergeben können.
Eine bereits erkrankte Katze kann symptomatisch behandelt werden; das bedeutet, die durch die Abwehrschwäche aufgetretenen Folgeerkrankungen können bekämpft werden, z.B. mit Antibiotika oder durch Entwurmungen usw. Tumore können mit Chemotherapeutika und Cortison im Wachstum gebremst, bisweilen sogar zum Verschwinden gebracht werden. Je nach Schwere des Krankheitsbildes ist jedoch oft die Euthanasie einer Behandlung vorzuziehen, um der Katze weiteres Leiden zu ersparen. Als Prophylaxe gegen diese Erkrankung ist die Impfung für alle Katzen mit Freigang und solche, die mit anderen Katzen in Kontakt kommen, z.B. auf Ausstellungen oder in Katzenpensionen, empfehlenswert. Die Grundimmunisierung erfolgt zweimal im Abstand von 2 bis 4 Wochen unabhängig vom Alter der Katze und sollte dann in jährlichem Abstand aufgefrischt werden. In manchen Tierarztpraxen wird vor der ersten Impfung ein Leukosetest durchgeführt, um den Nutzen der Impfung sicherzustellen, denn eine bereits an Leukose erkrankte Katze zu impfen ist zwar nicht schädlich, aber nutzlos. Der Test erspart dem Besitzer denn längerfristig diese Kosten, ist aber natürlich ein zusätzlicher Kostenfaktor bei der ohnehin nicht billigen Impfung.
Die Leukose gehörte lange Zeit mit zu den von Katzenbesitzern gefürchtetsten Erkrankungen, da sie unweigerlich tödlich verläuft und früher kein Impfstoff gegen Sie zur Verfügung stand. Seit einigen Jahren sind aber sogar mehrere Impfstoffe auf dem Markt. Unter nicht geimpften Katzen stellt Leukose jedoch immer noch die häufigste infektiöse Todesursache dar. Der Erreger ist wiederum ein Virus (FeLV = Felines Leukose-Virus), das zwar zur selben Gruppe von Viren zählt wie das humane Immunschwäche-Virus (HIV), der AIDS-Erreger, aber nicht auf Menschen übertragbar ist. Dieser Verwandtschaft entsprechend ähnelt die Leukose bei der Katze in ihrer Symptomatik teilweise dem erworbenen Immundefizienssyndrom (AIDS = Aquired Immunde Deliciency Syndrome) des Menschen. Das sogenannte "Katzen-AIDS" (siehe nächste Ausführung) wird allerdings durch ein anderes Virus (FIV = Felines Immundefizienz-Virus) hervorgerufen, das ebenfalls mit dem humanen HIV verwandt ist. Die Ansteckung erfolgt über direkten engen Kontakt beim friedlichen Zusammenleben, durch gegenseitiges Lecken; Putzen, gemeinsames Benutzen der Katzentoilette, sowie bei kämpferischen Auseinandersetzungen durch Bisse. Sie wird meist vom Besitzer nicht wahrgenommen, da sie zunächst nur zu einer leichten Erhöhung der Körpertemperatur führt. Die Mehrzahl der infizierten Katzen bildet in der Folge genügend Abwehrstoffe gegen das Virus und eliminiert es aus dem Körper. Lediglich 2 bis 6 % der einmal infizierten Katzen gelingt dies jedoch nicht. Sie bleiben Virusträger, scheiden es mit sämtlichen Körperflüssigkeiten aus und infizieren damit andere Katzen. Erste typische Symptome der Krankheit treten allerdings erst 1 bis 2 Jahre nach der Ansteckung auf. Die Symptome sind sehr vielfältig und beruhen auf der Vorliebe des Leukosevirus, Blutzellen und ihre Vorstufen zu befallen. Sind bereits die Vorstufen, die im Knochenmark gebildet werden, betroffen, werden nicht mehr genügend rote Blutkörperchen ins Blut nachgeliefert.
Der Mangel an roten Blutkörperchen (Anämie) macht sich in allgemeiner Schwäche und Müdigkeit bemerkbar. Die Schleimhäute im Mund und am Auge erscheinen dann blass, fast weiß. Werden dagegen die weißen Blutzellen geschädigt und zerstört, können sie ihre Aufgabe, andere Infektionen abzuwehren, nicht mehr erfüllen. Es entsteht das Bild der Immunschwäche, d.h. die Katze erkrankt häufiger und schwerer an anderen Infektionen, z.B. an Schnupfen. Sie leidet ständig an Durchfall, Ohren- und Zahnfleischentzündungen, oft starken Floh- und Wurmbefall, Abszessen und anderen Hauterkrankungen. Anstatt die weißen Blutzellen zu schädigen, vermag das Virus auch, sie zu vermehrtem Wachstum anzuregen, mit der Folge, dass Tumore in inneren Organen (Leber, Nieren, Milz), aber auch in der Haut oder in den Lymphknoten entstehen. Tumore bei jungen Katzen sind immer leukosebedingt. Den Nachweis einer Leukose liefert im Verdachtsfall ein Leukosetest, ein relativ einfach und schnell durchzuführender Bluttest, mit dem das Virus im Blut entdeckt werden kann. Während bei einer kranken Katze ein positives Testergebnis eine Leukose beweist, zeigt es bei einer klinisch gesunden Katze nur an, dass sie sich gerade mit dem Virus auseinandersetzt. In diesem Fall muss der Test nach 3 Monaten wiederholt werden, um zu sehen, ob ihr Immunsystem das Virus erfolgreich abgewehrt hat oder ob die Katze als permanent infiziert anzusehen ist. Natürlich sollte die Katze auf Grund der Ansteckungsgefahr in der Zwischenzeit von anderen Katzen getrennt gehalten werden. Im Falle eines positiven Leukosetests ergibt sich die Frage nach einer möglichen und sinnvollen Behandlung. Prinzipiell ist Leukose nicht heilbar, aber leukosepositive Tiere, die noch keine Krankheitserscheinungen zeigen, können trotz Infektion durchaus noch einige Jahre weiterleben. Selbstverständlich sollte ihnen keinesfalls Freigang gewährt werden, da sie ja das Virus weitergeben können.
Eine bereits erkrankte Katze kann symptomatisch behandelt werden; das bedeutet, die durch die Abwehrschwäche aufgetretenen Folgeerkrankungen können bekämpft werden, z.B. mit Antibiotika oder durch Entwurmungen usw. Tumore können mit Chemotherapeutika und Cortison im Wachstum gebremst, bisweilen sogar zum Verschwinden gebracht werden. Je nach Schwere des Krankheitsbildes ist jedoch oft die Euthanasie einer Behandlung vorzuziehen, um der Katze weiteres Leiden zu ersparen. Als Prophylaxe gegen diese Erkrankung ist die Impfung für alle Katzen mit Freigang und solche, die mit anderen Katzen in Kontakt kommen, z.B. auf Ausstellungen oder in Katzenpensionen, empfehlenswert. Die Grundimmunisierung erfolgt zweimal im Abstand von 2 bis 4 Wochen unabhängig vom Alter der Katze und sollte dann in jährlichem Abstand aufgefrischt werden. In manchen Tierarztpraxen wird vor der ersten Impfung ein Leukosetest durchgeführt, um den Nutzen der Impfung sicherzustellen, denn eine bereits an Leukose erkrankte Katze zu impfen ist zwar nicht schädlich, aber nutzlos. Der Test erspart dem Besitzer denn längerfristig diese Kosten, ist aber natürlich ein zusätzlicher Kostenfaktor bei der ohnehin nicht billigen Impfung.
Katzen-"AIDS"
Diese Erkrankung zeigt ebenfalls das bereits bei der Leukose beschriebene Bild einer allgemeinen Immunschwäche, mit dem Unterschied, dass ein anderes Virus für sie verantwortlich ist. Dieses erst seit 1986 bekannte Virus wird als FIV = Felines Immundefizienz-Virus bezeichnet und ist ebenfalls eng verwandt mit dem HIV-Virus, weshalb sich für diese Erkrankung der Begriff "Katzen-Aids" eingebürgert hat. Auch hier ist anzunehmen, dass trotz der relativ engen Verwandtschaft der drei Viren (Leukosevirus, FIV und HIV) keine Übertragung von Mensch auf Katze oder umgekehrt erfolgen kann. Unter Katzen wird das FIV-Virus nur durch direkten Kontakt übertragen, und zwar vorrangig durch Bisse. Daher sind unkastrierte Kater, die sich häufig Revierkämpfen unterziehen, wesentlich gefährdeter als weibliche und kastrierte Tiere. Durch die Infektion kommt es zu einer Abwehrschwäche, die sich folgendermaßen äußern kann: - Appetit- und Gewichtsverlust, - Fieber, - chronische Zahnfleisch- und Maulhöhlenentzündungen - chronische Bronchitiden und Lungenentzündungen - Hautinfektionen - häufige Abszesse. "Katzen-AIDS" kann wie die Leukose durch eine Blutuntersuchung nachgewiesen werden. Diese ist in Verdachtsfällen, besser noch vor einer aufwendigen Therapie der Symptome (z.B. operatives Spalten von Abszessen, Zahnbehandlungen), der ansonsten kein Langzeiterfolg beschieden sein wird, einzuleiten. Eine Impfung und somit Prophylaxe ist bisher nicht möglich. Die Kastration der Kater vermindert das Infektionsrisiko und somit die weitere Ausbreitung.
Diese Erkrankung zeigt ebenfalls das bereits bei der Leukose beschriebene Bild einer allgemeinen Immunschwäche, mit dem Unterschied, dass ein anderes Virus für sie verantwortlich ist. Dieses erst seit 1986 bekannte Virus wird als FIV = Felines Immundefizienz-Virus bezeichnet und ist ebenfalls eng verwandt mit dem HIV-Virus, weshalb sich für diese Erkrankung der Begriff "Katzen-Aids" eingebürgert hat. Auch hier ist anzunehmen, dass trotz der relativ engen Verwandtschaft der drei Viren (Leukosevirus, FIV und HIV) keine Übertragung von Mensch auf Katze oder umgekehrt erfolgen kann. Unter Katzen wird das FIV-Virus nur durch direkten Kontakt übertragen, und zwar vorrangig durch Bisse. Daher sind unkastrierte Kater, die sich häufig Revierkämpfen unterziehen, wesentlich gefährdeter als weibliche und kastrierte Tiere. Durch die Infektion kommt es zu einer Abwehrschwäche, die sich folgendermaßen äußern kann: - Appetit- und Gewichtsverlust, - Fieber, - chronische Zahnfleisch- und Maulhöhlenentzündungen - chronische Bronchitiden und Lungenentzündungen - Hautinfektionen - häufige Abszesse. "Katzen-AIDS" kann wie die Leukose durch eine Blutuntersuchung nachgewiesen werden. Diese ist in Verdachtsfällen, besser noch vor einer aufwendigen Therapie der Symptome (z.B. operatives Spalten von Abszessen, Zahnbehandlungen), der ansonsten kein Langzeiterfolg beschieden sein wird, einzuleiten. Eine Impfung und somit Prophylaxe ist bisher nicht möglich. Die Kastration der Kater vermindert das Infektionsrisiko und somit die weitere Ausbreitung.
Infektiöse Bauchfellentzündung (FIP)
Bei dieser Erkrankung handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Entzündung des Bauchfells, das die Bauchhöhle von innen auskleidet. Diese Bauchfellentzündung heißt auch Peritonitis, woher sich die gebräuchliche Abkürzung ableitet: FIP _ Feline Infektiöse Peritonitis. Das hierfür verantwortliche Virus ist zwar bekannt, wie es die krankhaften Veränderungen hervorruft ist aber noch nicht ganz geklärt. Betroffen sind meist Katzen im Alter zwischen 5 Monaten und 4 Jahren, wobei zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Erkrankung bis zu 4 Monate vergehen können. Symptome: Die Infektion äußert sich zunächst durch Fieber zwischen 39° C und 41° C, das in Intervallen auftritt und Mattigkeit und Fressunlust nach sich zieht. Im weiteren Verlauf, der sich über mehrere Wochen hinziehen kann, kommt es durch die Baufellentzündung zu einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle, die äußerlich als deutliche Umfangsvermehrung des Bauches sichtbar wird. Besonders auffällig wird diese Umfangvermehrung durch die gleichzeitige Abmagerung des restlichen Körpers. Bei diesem "klassischen" Bild der FIP kann die Verdachtsdiagnose relativ leicht gestellt und durch eine Punktion der Bauchhöhle, bei der eine für die Krankheit typische gelbliche Flüssigkeit gewonnen wird, vom Tierarzt abgesichert werden. Schwieriger wird es in Fällen, in denen nicht das Bauchfell, sondern, wie gleichermaßen möglich, das Brustfell, also die Brusthöhlenauskleidung betroffen ist. Wegen der Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle äußert sich diese Form der Erkrankung durch Schwierigkeiten bei der Atmung. Die Katze atmet verstärkt mit dem Bauch, sie öffnet zum Atmen das Maul und hechelt, obwohl keine Veranlassung dazu besteht, wie z.B. Hitze oder Aufregung. Hier kann ein Röntgenbild, dass das Bestehen einer Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle anzeigt, und daraufhin wiederum die Gewinnung des typischen Punktats die Verdachtsdiagnose bestätigen. In manchen Fällen der FIP treten allerdings keine Ergüsse in die Körperhöhlen auf. Bei dieser sogenannten "trockenen" Form der FIP besteht lediglich eine Entzündung der Auskleidung. Die Diagnose kann hier nur mit Hilfe einiger Blutwerte gestellt werden. Vor oder gleichzeitig mit den genannten Symptomen können auch Augenveränderungen in Form ein- oder beidseitiger Ergüsse in die vordere Augenkammer auftreten. Eine Behandlung ist nicht möglich, es kann nur die Euthanasie angeraten werden. Seit November 1993 ist ein Impfstoff gegen FIP, der in der USA bereits seit längerem verwendet wird, auch in Deutschland zugelassen. Der Impfstoff (Primucell FIP) wird nicht injiziert, sondern in die Nase eingeträufelt. Dies muss bei einer einmaligen Impfung nach drei Wochen nochmals wiederholt werden. Der Impfschutz hält dann ein Jahr an. Häufig lassen Tierheime Anitkörper-Titerbestimmungen für FIP bei ihren Fundtieren durchführen, die dies dann als FIP-positive oder FIP-negative Tiere ausweisen. Diese Titerbestimmungen besitzen wenig bis gar keine Aussagekraft darüber, ob eine offenbar gesunde Katze an FIP erkranken wird oder nicht. Lediglich bei bereits vorhandenen Symptomen können solche Untersuchungen zur Diagnose mit herangezogen werden.
Bei dieser Erkrankung handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine Entzündung des Bauchfells, das die Bauchhöhle von innen auskleidet. Diese Bauchfellentzündung heißt auch Peritonitis, woher sich die gebräuchliche Abkürzung ableitet: FIP _ Feline Infektiöse Peritonitis. Das hierfür verantwortliche Virus ist zwar bekannt, wie es die krankhaften Veränderungen hervorruft ist aber noch nicht ganz geklärt. Betroffen sind meist Katzen im Alter zwischen 5 Monaten und 4 Jahren, wobei zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Erkrankung bis zu 4 Monate vergehen können. Symptome: Die Infektion äußert sich zunächst durch Fieber zwischen 39° C und 41° C, das in Intervallen auftritt und Mattigkeit und Fressunlust nach sich zieht. Im weiteren Verlauf, der sich über mehrere Wochen hinziehen kann, kommt es durch die Baufellentzündung zu einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle, die äußerlich als deutliche Umfangsvermehrung des Bauches sichtbar wird. Besonders auffällig wird diese Umfangvermehrung durch die gleichzeitige Abmagerung des restlichen Körpers. Bei diesem "klassischen" Bild der FIP kann die Verdachtsdiagnose relativ leicht gestellt und durch eine Punktion der Bauchhöhle, bei der eine für die Krankheit typische gelbliche Flüssigkeit gewonnen wird, vom Tierarzt abgesichert werden. Schwieriger wird es in Fällen, in denen nicht das Bauchfell, sondern, wie gleichermaßen möglich, das Brustfell, also die Brusthöhlenauskleidung betroffen ist. Wegen der Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle äußert sich diese Form der Erkrankung durch Schwierigkeiten bei der Atmung. Die Katze atmet verstärkt mit dem Bauch, sie öffnet zum Atmen das Maul und hechelt, obwohl keine Veranlassung dazu besteht, wie z.B. Hitze oder Aufregung. Hier kann ein Röntgenbild, dass das Bestehen einer Flüssigkeitsansammlung in der Brusthöhle anzeigt, und daraufhin wiederum die Gewinnung des typischen Punktats die Verdachtsdiagnose bestätigen. In manchen Fällen der FIP treten allerdings keine Ergüsse in die Körperhöhlen auf. Bei dieser sogenannten "trockenen" Form der FIP besteht lediglich eine Entzündung der Auskleidung. Die Diagnose kann hier nur mit Hilfe einiger Blutwerte gestellt werden. Vor oder gleichzeitig mit den genannten Symptomen können auch Augenveränderungen in Form ein- oder beidseitiger Ergüsse in die vordere Augenkammer auftreten. Eine Behandlung ist nicht möglich, es kann nur die Euthanasie angeraten werden. Seit November 1993 ist ein Impfstoff gegen FIP, der in der USA bereits seit längerem verwendet wird, auch in Deutschland zugelassen. Der Impfstoff (Primucell FIP) wird nicht injiziert, sondern in die Nase eingeträufelt. Dies muss bei einer einmaligen Impfung nach drei Wochen nochmals wiederholt werden. Der Impfschutz hält dann ein Jahr an. Häufig lassen Tierheime Anitkörper-Titerbestimmungen für FIP bei ihren Fundtieren durchführen, die dies dann als FIP-positive oder FIP-negative Tiere ausweisen. Diese Titerbestimmungen besitzen wenig bis gar keine Aussagekraft darüber, ob eine offenbar gesunde Katze an FIP erkranken wird oder nicht. Lediglich bei bereits vorhandenen Symptomen können solche Untersuchungen zur Diagnose mit herangezogen werden.
Tollwut
Von den viralen Infektionen der Katze ist die Tollwut die einzige, die auch für den Menschen gefährlich ist. Das Reservoir für das Tollwutvirus sind Wildtiere, bevorzugt Füchse, die mit ihrem Speichel meist durch Bisse Haustiere infizieren. Voraussetzung für die Ansteckung sind zumindest kleine Verletzungen der Haut, durch die das Virus überhaupt erst in den Körper eindringen kann. Von dort gelangt es über die Nervenbahnen zu seinem Ziel, dem Gehirn, wo es sich vermehrt. Mit seiner Vermehrung setzt es eine Entzündung im Gehirn in Gang, welche die Ursache der auffälligen Verhaltensänderungen ist. Auf umgekehrten Wege wandert das Virus danach zurück in die Speicheldrüsen. Die Inkubationszeit ist daher auch abhängig davon, wie weit die Verletzung vom Kopf entfernt ist und schwankt in der Regel zwischen 14 und 30 Tagen. Junge Katzen reagieren empfänglicher auf das Virus als ältere. Nach dem klinischen Bild unterscheidet man die stille Wut und die rasende Wut, wobei die letztere häufiger bei Katzen beobachtet wird. Der Begriff deutet schon an, welche Verhaltensänderung mit der Katze vor sich geht: sie wird plötzlich, obwohl vorher eher zahm und ruhig, aggressiv und greift Menschen und besonders auch Hunde an. Bei der stillen Wut sieht man das Gegenteil: sonst eher scheue Tiere werden plötzlich zutraulich. Zu den Verhaltensänderungen kommen dann noch Muskelzuckungen, Speichelfluss, Gleichgewichtsstörungen und im Endstadium Krämpfe, Lähmungen und Bewusstlosigkeit, bis der Tod eintritt. Am lebenden Tier lässt sich nur die Verdachtsdiagnose "Tollwut" stellen. Erst nach dem Tode kann dieser Verdacht durch histologische und immunologische Untersuchungen, im Rahmen derer die Gehirnzellen speziell angefärbt und mikroskopisch begutachtet werden, bestätigt werden. Eine Behandlung verdächtiger Tiere ist untersagt. Nach Anordnung des Amtstierarztes hat möglicherweise sogar statt Quarantäne die sofortige Tötung zu erfolgen. Am besten geschützt wird die freilaufende Katze und gleichzeitig auch der Mensch durch die Impfung gegen Tollwut. Sie ist ab dem 3. Lebensmonat möglich und muss jährlich erneuert werden.
Katzenpocken
Obwohl Erreger der Menschenpocken seit Jahren ausgerottet ist, zirkulieren bei einzelnen Tierspezies immer noch an die verschiedenen Tierarten angepassten Pockenviren. Neuerdings ist auch bei Katzen eine Pockenerkrankung beobachtet worden. Die Bekämpfung dieser noch seltenen Seuche muss dem Tierarzt überlassen werden. Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut) Zu guter Letzt sei noch diese Infektionskrankheit aufgeführt, da sie in den letzten Jahren wiederholt für Schlagzeilen in der Presse sorgte. Sie ist eigentlich eine Virusinfektion der Schweine, kann aber von ihnen auf nahezu alle anderen Säugetiere übertragen werden. Bei Katzen geschieht dies entweder durch den direkten Kontakt zu Schweinen, z.B. auf Bauernhöfen, oder - häufiger - durch das Verfüttern rohen Schweinefleisches. Der Mensch, der sich auf dem gleichen Wege infiziert, scheint relativ unempfindlich für diese Seuche zu sein, er erkrankt, wenn überhaupt, nur sehr milde daran. Wie der Ausdruck "Pseudowut" schon aussagt, stehen auch hier wie bei der Tollwut nervöse Symptome im Vordergrund, die 2 bis 4 Tage nach der Ansteckung erscheinen: Unruhe, Speicheln, Schluckbeschwerden und Futterverweigerung. Ganz typisch ist ein unstillbarer Juckreiz, weshalb die Krankheit auch als "Juckseuche" bezeichnet wird. Der Tod tritt bereits 12 bis 48 Stunden später ein. Die Aujeszkysche Krankheit wird in der BRD durch Impfaktionen in den Schweinebeständen staatlich bekämpft. Eine Impfung ist prinzipiell auch für Katzen möglich, in Anbetracht viel einfacherer prophylaktischer Maßnahmen aber kaum nötig. Denn der wichtigste Übertragungsweg ist leicht zu blockieren, indem kein rohes Schweinefleisch an Katzen verfüttert wird.
Obwohl Erreger der Menschenpocken seit Jahren ausgerottet ist, zirkulieren bei einzelnen Tierspezies immer noch an die verschiedenen Tierarten angepassten Pockenviren. Neuerdings ist auch bei Katzen eine Pockenerkrankung beobachtet worden. Die Bekämpfung dieser noch seltenen Seuche muss dem Tierarzt überlassen werden. Aujeszkysche Krankheit (Pseudowut) Zu guter Letzt sei noch diese Infektionskrankheit aufgeführt, da sie in den letzten Jahren wiederholt für Schlagzeilen in der Presse sorgte. Sie ist eigentlich eine Virusinfektion der Schweine, kann aber von ihnen auf nahezu alle anderen Säugetiere übertragen werden. Bei Katzen geschieht dies entweder durch den direkten Kontakt zu Schweinen, z.B. auf Bauernhöfen, oder - häufiger - durch das Verfüttern rohen Schweinefleisches. Der Mensch, der sich auf dem gleichen Wege infiziert, scheint relativ unempfindlich für diese Seuche zu sein, er erkrankt, wenn überhaupt, nur sehr milde daran. Wie der Ausdruck "Pseudowut" schon aussagt, stehen auch hier wie bei der Tollwut nervöse Symptome im Vordergrund, die 2 bis 4 Tage nach der Ansteckung erscheinen: Unruhe, Speicheln, Schluckbeschwerden und Futterverweigerung. Ganz typisch ist ein unstillbarer Juckreiz, weshalb die Krankheit auch als "Juckseuche" bezeichnet wird. Der Tod tritt bereits 12 bis 48 Stunden später ein. Die Aujeszkysche Krankheit wird in der BRD durch Impfaktionen in den Schweinebeständen staatlich bekämpft. Eine Impfung ist prinzipiell auch für Katzen möglich, in Anbetracht viel einfacherer prophylaktischer Maßnahmen aber kaum nötig. Denn der wichtigste Übertragungsweg ist leicht zu blockieren, indem kein rohes Schweinefleisch an Katzen verfüttert wird.